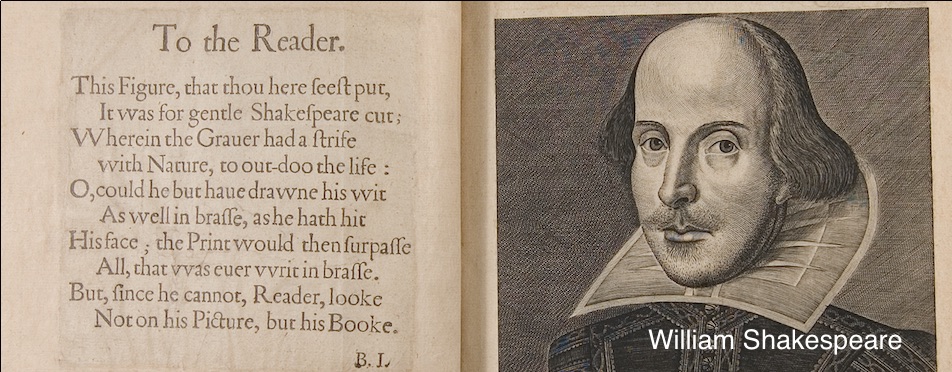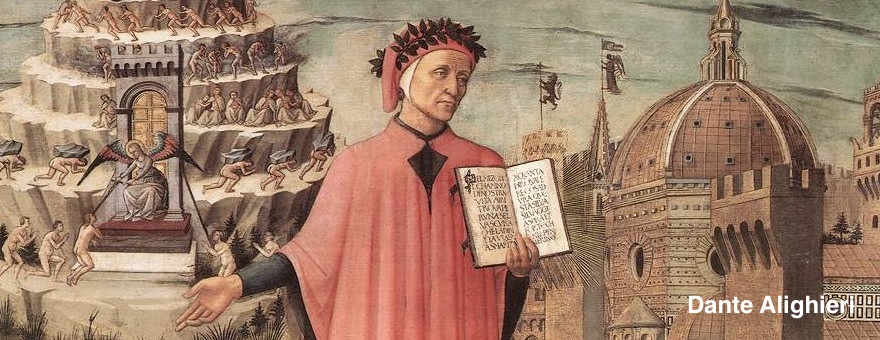21. und 28.1.2025
DR. PHIL. JAKOB KNAUS
MUSIK ZU FRIEDEN UND KRIEG

Die vom Referenten in seinen Vorträgen präsentierten Musikstücke verdeutlichen, dass Komponisten auf sehr unterschiedliche Weise mit den Themen Krieg und Frieden umgehen. Während einige Werke den Frieden feiern, setzen sich andere mit den Grausamkeiten des Krieges auseinander und mahnen zur Versöhnung.
Die "Feuerwerksmusik" komponierte Georg Friedrich Händel (1685–1759) im Jahre 1749 anlässlich des Friedens von Aachen, der den Österreichischen Erbfolgekrieg beendete. Der Satz "La Paix" (Der Frieden) zeichnet ein musikalisches Bild der Ruhe und Eintracht. Bei Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) ist "La Batalia" ein musikalisches Schlachtengemälde von 1673, das vermutlich für eine Karnevalsveranstaltung gedacht war. Es verdeutlicht durch Dissonanzen und ungewöhnliche musikalische Effekte die "liederliche Gesellschaft" und die chaotische "Schlacht". Die "Paukenmesse" komponierte Joseph Haydn (1732–1809) 1796 in den Wirren des ersten Koalitionskrieges gegen Napoleon, wobei das "Dona nobis pacem" zu einer eindringlichen Bitte um Frieden ertönt. Auch Ludwig von Beethoven (1770-1827) darf mit seiner Komposition "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bey Vittoria" (1813) erwähnt werden, wo er die Schlacht musikalisch nachstellt. Die detaillierten Anweisungen zur Aufführung, einschließlich der Platzierung von Musikern und der Verwendung von Kanonen und Ratschen, lassen die Schlacht lebendig werden. Ein weiterer Komponist zum Thema war Benjamin Britten (1913-1976). Sein "War Requiem" von 1962 ist eine Reaktion auf die Bombardierung von Coventry im Zweiten Weltkrieg. Durch die Kombination des lateinischen Requiem-Textes mit Antikriegsgedichten von Wilfried Owen und die Aufteilung der Gesangspartien auf Solisten aus kriegführenden Nationen (Russland, England, Deutschland) entsteht ein eindringliches Mahnmal gegen die Schrecken des Krieges. Die 7. Sinfonie von Dimitri Schostakowitsch (1906-1975), die "Leningrader", entstand während des Zweiten Weltkriegs und der Belagerung von Leningrad. Der erste Satz, bekannt für sein "Invasionsthema", wird oft auf den deutschen Überfall bezogen. Schostakowitsch selbst betonte jedoch, dass die Sinfonie das von Stalin zerstörte Leningrad und die Gräuel des Totalitarismus thematisiert. Zitate wie "Da geh ich ins Maxim" (Lehár) und das "Gewaltmotiv" aus seiner Oper "Lady Macbeth von Mzensk" deuten auf eine breitere Kritik an Gewalt und Unterdrückung hin. Tschaikowskys Ouvertüre "1812" wurde zur Einweihung der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau komponiert und erinnert an den Sieg über Napoleon. Das Werk zitiert die "Marseillaise" als Symbol für die französische Invasion, die jedoch von russischen Melodien und Glockengeläut überlagert wird, was den russischen Sieg darstellt. Weitere Musikbeispiele des Referenten analysierten, wie Musik im Zweiten Weltkrieg und danach als Mittel des Widerstands und der Propaganda eingesetzt wurde. In "Casablanca" (1942) wird die "Wacht am Rhein" der deutschen Soldaten durch die "Marseillaise" der französischen Patrioten konterkariert. In Günter Grass' "Die Blechtrommel" (1959) stört Oskar Matzerath mit seinem Dreiertakt auf der Trommel den Aufmarsch der Wehrmacht, was als subversive Handlung gegen den Nationalsozialismus interpretiert werden kann. Swing-Musik, die von den Nazis als "undeutsch" und "jüdisch" diffamiert wurde, wurde im Untergrund gehört und von Musikern wie Teddy Stauffer trotz Verbote gespielt. Das "Lied vom Feldzug im Osten" (1941) von Norbert Schultze, das exemplarisch für den Angriff auf die Sowjetunion eingesetzt wurde, enthält die "Russland-Fanfare" aus Liszts "Les Préludes" und zeigt die ideologische Vereinnahmung von Musik für Kriegszwecke.
Wir danken dem Referenten erneut für die jährlichen, eindrücklichen, mit Musikbeispielen untermalten Ausführungen zur Musikgeschichte und freuen uns bereits auf seine Musikvorträge zur französischen Orchestermusik im nächsten Jahr.
|
Created by SJL Creations, see more on http://www.sjlcreations.be |
 |